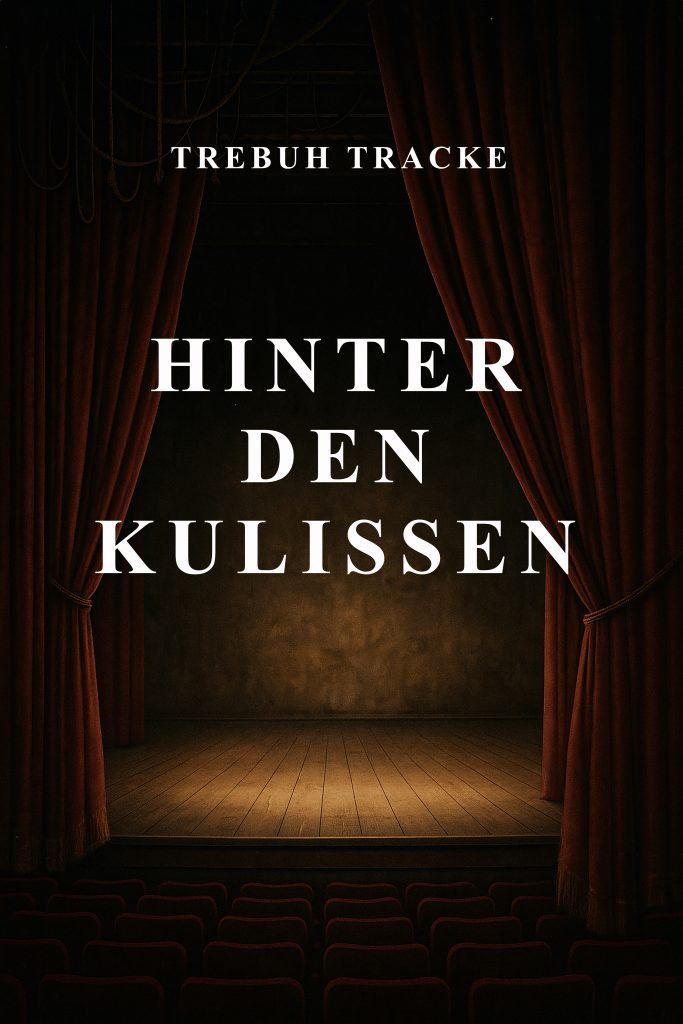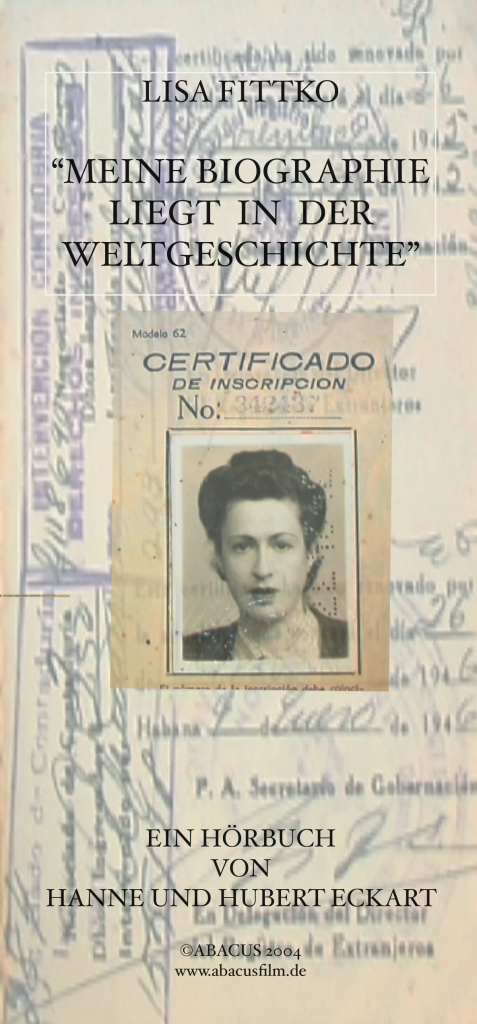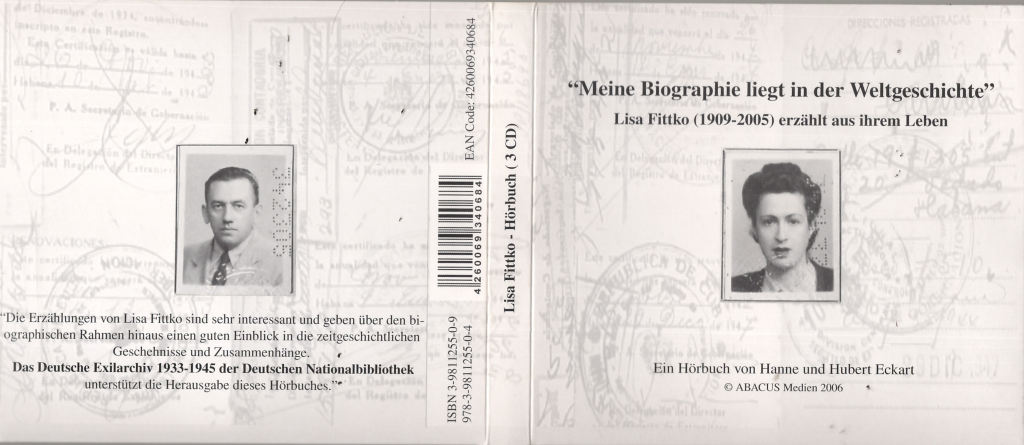Treffen sich zwei Theaterkritiker…
Kritikergespräch
Treffen sich zwei Theaterkritiker in einem Bahnhofsrestaurant. Der eine ist älter, der andere ist jünger.
Meier:
Hallo Krause, na das ist ja eine Überraschung. Sind sie auch wieder einmal Dank der Bahn gestrandet?
Krause:
Ja, Oberleitungsschaden. Woraus werden eigentlich Oberleitungen gemacht, ich dachte immer aus Stahl?
Meier:
Wahrscheinlich hat man heute ein neues Material erfunden, das in Vietnam hergestellt wird und so die Bahn viel Geld sparen kann. Ich bestelle ihnen gleich mal ein Bier, das hilft.
Krause:
Das ist gut, Danke. Wohin waren Sie den unterwegs?
Meier:
Fragen Sie lieber nicht wohin ich gemusst hätte, fragen Sie, was mir erspart bleibt anzusehen.
Krause:
Ich wollte mir die neueste performance der Gruppe Tzzzkrch in N. ansehen, das soll spektakulär sein. Und Sie?
Meier:
Die Räuber NACH Schiller, ich bin froh, dass auf die Zugausfälle der Bahn noch verlaß ist.
Krause:
Sie sollten nicht so defätistisch sein, das Theater ist lebendig und warum nicht mal die Räuber NACH Schiller spielen?
Meier:
Die aktuelle Gegenfrage lautet: Warum nicht wenigstens einmal die Räuber VON Schiller spielen? Es soll Theaterbesucher geben, die wegen eines Ihnen bekannten Stücktitels ins Theater gehen.
Krause:
Das war früher, als es noch Abonnenten gab. Heute geht man, um einem live act beizuwohnen, ein event zu erleben.
Meier:
Live act, event – das ist das Blödsprech. Theater ist seit 2000 Jahren live und was ist überhaupt ein event? Ein Erlebnis?
Krause:
Ja,ja – aber eben ein besonderes, was mich aus dem Alltag herausholt?
Meier:
Ah!, und deshalb werden ständig die Probleme des Alltags auf der Bühne verhandelt?
Krause:
Aber eben künstlerisch überhöht!! Darauf kommt es doch an, Herr Kollege!
Meier:
Aha. Kennen Sie den Unterschied zwischen einem modernen und einem überholten Theater?
Krause:
Ja schon, man muss vor allem die gender…
Meier:
In einem überholten Theater standen nackte Frauen auf der Bühne, im modernen sind es jetzt die Männer.
Krause:
Und wo ist die Pointe?
Meier:
Gibt keine, das ist der Witz.
Krause:
Dann ist es auch nicht lustig.
Meier:
Genau, es ist nicht lustig. Ich war neulich in einer Aufführung bei der das Regieteam zu 100% aus Frauen bestand und alle männlichen Darsteller auf der Bühne nackt waren, aber die weiblichen angezogen.
Krause:
Worum ging es in diesem Stück?
Meier:
Keine Ahnung, das habe ich nicht herausgefunden, aber wahrscheinlich ging es darum, Männer nackt auf die Bühne zu stellen.
Krause:
Tja, da kann MAN eben auch mal sehen, wie erniedrigend es vor allem für Frauen war, nackt auf der Bühne zu stehen.
Meier:
Papperlapapp, man muss überhaupt niemand nackt auf die Bühne stellen. Auf die Bühne gehören Schauspieler vor allem gute, denn die können alles spielen, auch Nacktheit, obwohl die angezogen sind.
Krause:
Und SchauspielerINNEN, sehen Sie….
Meier:
Was sehe ich?
Krause:
Sie sprechen schon wieder nur von Schauspielern…
Meier
… schon mal vom generischen Maskulinum gehört, Herr Kollege…
Krause:
Nu werden Sie mal nicht dreist, es geht hier nicht um Grammatik sondern Geschlechtergerechtigkeit. Und in den letzten Jahrhunderten wurden die Frauen immer unterdrückt, dann müssen eben jetzt mal die Männer erleben, wie sich das anfühlt.
Meier:
Das können Sie gerne in ihrer Agit-Prop-Gruppe oder in einem ayoverdischen Stuhlkreis ausdiskutieren, aber doch bitte nicht auf dem Theater, wo der arme Zuschauer auch Geld dafür bezahlt.
Krause:
Wir fordern doch immer, das auf dem Theater die wichtigen Gesellschaftsfragen verhandelt werden, aber wenns mal wehtut, dann gefällt es uns nicht.
Meier:
Es tut weh, dass vollkommen unwichtige Fragen breitgetreten werden.
Krause:
Also geht es darum, wer entscheidet, welche Fragen, die wichtigen sind?
Meier:
Früher war das keine Frage, Theater war eine Ensemblekunst in dem Sinne, dass Autoren die Stücke schrieben, die Dramaturgen lasen und den Regisseuren vorschlugen, die dann den Schauspielern halfen, die Geschichte durch eine überzeugende Darstellung der Rollen zu erzählen. Am Ende entschied das Publikum, was davon zu halten war.
Heute machen einfach alle alles, das Ergebnis ist ein inhaltsloses Durcheinander, genannt Performance…
Krause
Sie vereinfachen aber sehr stark, Herr Kollege, man muss schon etwas mit der Zeit gehen.
Meier
„Denn alles was so übertrieben wird, ist dem Vorhaben des Schauspiels, dessen Zweck sowohl Anfangs als jetzt war und ist, der Natur gleichsam den Spiegel vorzuhalten, der Tugend, die eignen Züge, der Schmach, ihr eignes Bild und dem Jahrhundert und Körper und der Zeit den Abdruck seiner Gestalt zu zeigen.“
Krause
Schön zitiert, aus welchem Folianten habt ihr das?
Meier
Hamlets Rede an die Schauspieler.
Krause
Oh!
Meier
Neulich war ich auf einer Konferenz mit dem Titel „Die Zukunft des Theaters“.
Krause
Und wie war es?
Meier
Es kann einem Angst und Bange werden.
Krause
Wie wird denn die Zukunft aussehen?
Meier
Divers, antirassistisch, gendergerecht und vor allem nachhaltig.
Krause
Na, das ist doch alles sehr gut.
Meier
Ja, nur leider wird das Theater keine Inhalte mehr haben, weil alle nicht nur alles gleichzeitig machen, sondern auch noch stets und ständig sich belauern müssen, ob sie diese Kriterien auch wirklich erfüllen. Es kommt einfach nur noch auf die richtigen Phrasen an.
Krause
Sie sind wirklich ein Schwarzmaler.
Meier
Nein, ich bin Theaterkritiker. Gewesen. – Noch zwei Bier bitte!
Krause
Nun machen Sie mal halblang. Das Theater hatte doch wirklich einiges an Machtmißbrauch zu bieten, das kann man doch nicht ignorieren.
Meier
Das ist doch eine Selbstverständlichkeit.
Machtmißbrauch ist Machtmißbrauch.
Aber soll ein Dirigent sein Orchester stets fragen, ob auch wirklich alle einverstanden sind und sich nicht diskriminiert fühlen, wenn sie einsetzen genau dann, wenn er den Taktstock runter schlägt?
Irgendein vernünftiger Mensch hat einmal gesagt „Theater ist keine basisdemokratische Veranstaltung!“
Wer Macht hat, hat Verantwortung und dafür muss er einer vorbildlichen Elite angehören, aber dieses Wort ist ja inzwischen auch unter die Räder der Zensur gekommen.
Krause
Ich weiß wirklich nicht, was dagegen spricht, am Theater mehr Demokratie zu wagen?
Meier
Sie haben auch nicht die Zeiten des Mitbestimmungstheaters in den 70ern miterlebt.
Krause
Dafür kann ich nichts, das ist die Gnade der späteren Geburt.
Meier
Na, ob das eine Gnade ist…
Krause
Offensichtlich leide ich nicht so sehr unter dem modernen Thester wie Sie.
Meier
Kennen Sie Dr. Murkes gesammeltes Schweigen von Heinrich Böll?
Krause
Nein, ist das ein Theaterstück?
Meier
Nein, das ist eine Novelle. Sie handelt von einem Tonmeister, der sich alle Pausen, jeden Moment der Stille aus den Tonbändern der Rundfunkproduktionen rausschneidet und aufhebt. Und wenn er wieder einmal wegen des unsäglichen Geplappers kurz vor einer Depression ist, dann spielt er sich diese Sekunden des Schweigens vor.
Krause
Eine schöne Metapher nur leider völlig unpassend für das Theater.
Meier
Sie haben vor lauter performance wirklich jeden Sinn für Poesie verloren.
Krause
Aber wenigstens kriege ich keine Depressionen.
Meier
Ja, auch nicht mal mehr das.
Krause
Ihre Anzüglichkeiten nehmen in einem nicht zu akzeptierenden Maße zu.
Meier
Melden Sie mich doch der Antidiskriminierungskommission.
Krause
Vielleicht sollten wir beide uns mal eine Unterhaltung mit einem Mediator gönnen?
Meier
Ja, sehr gerne, aber unter einer Bedingung: jeder Teilnehmer muss alle Stücke Shakespeares gelesen haben und die Unterhaltung darf ausschließlich aus Zitaten aus diesen Werken bestehen.
Krause
Das ist völlig unrealistisch, dafür hat niemand Zeit. – Apropo: da wird mein Zug angezeigt, anscheinend ist der Oberleitungsschaden behoben und ich komme vielleicht noch zur Pause zurecht und kann mir wenigstens den zweiten Teil ansehen.
Meier
Herzliches Beileid, ich bestelle mir ein drittes Bier und gehe dann ins Hotel und lese Hamlet, das Stück habe ich immer dabei.
Krause
Haha…“Sein oder Nichtsein…“ usw.
Meier
Nein.
„Schlafen! Vielleicht auch träumen! Ja, da liegts:
Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen,
Wenn wir die irdische Verstrickung lösten,
Das zwingt uns stillzustehn.
Das ist die Rücksicht,
Die Elend läßt zu hohen Jahren kommen.
Denn wer ertrüg der Zeiten Spott und Geißel,
Des Mächtigen Druck, des Stolzen Mißhandlungen,
Verschmähter Liebe Pein, des Rechtes Aufschub,
Den Übermut der Ämter und die Schmach,
Die Unwert schweigendem Verdienst erweist,
Wenn er sich selbst in Ruhstand setzen könnte“
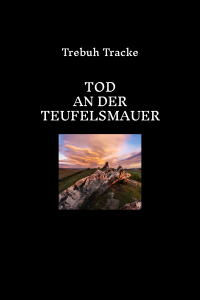
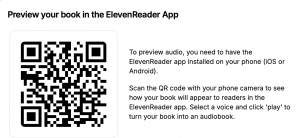
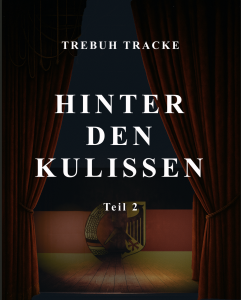 Der zweite Teil des Romans erzählt die Geschichte des Stadttheaters einer thüringischen Kleinstadt während der Wendezeit und der ersten Monate nach der deutschen Wiedervereinigung. Im Zentrum steht Paul Derenburg, 58-jähriger Technischer Direktor des Theaters, der zusammen mit seinen Kollegen die dramatischen Umwälzungen dieser Zeit erlebt.
Der zweite Teil des Romans erzählt die Geschichte des Stadttheaters einer thüringischen Kleinstadt während der Wendezeit und der ersten Monate nach der deutschen Wiedervereinigung. Im Zentrum steht Paul Derenburg, 58-jähriger Technischer Direktor des Theaters, der zusammen mit seinen Kollegen die dramatischen Umwälzungen dieser Zeit erlebt.