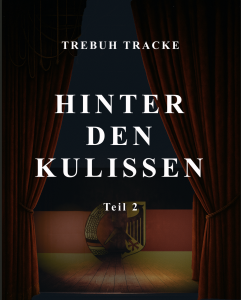 Der zweite Teil des Romans erzählt die Geschichte des Stadttheaters einer thüringischen Kleinstadt während der Wendezeit und der ersten Monate nach der deutschen Wiedervereinigung. Im Zentrum steht Paul Derenburg, 58-jähriger Technischer Direktor des Theaters, der zusammen mit seinen Kollegen die dramatischen Umwälzungen dieser Zeit erlebt.
Der zweite Teil des Romans erzählt die Geschichte des Stadttheaters einer thüringischen Kleinstadt während der Wendezeit und der ersten Monate nach der deutschen Wiedervereinigung. Im Zentrum steht Paul Derenburg, 58-jähriger Technischer Direktor des Theaters, der zusammen mit seinen Kollegen die dramatischen Umwälzungen dieser Zeit erlebt.
Die Handlung beginnt am 9. Januar 1990 bei einer Dienstagdemonstration, bei der sich 30.000 Menschen versammeln – mehr als je zuvor in der Geschichte der Stadt. Das Theater stellt Bühne und Technik zur Verfügung. Pfarrer Bernd Reuther und der Schauspieler Boris Tenkow sprechen zur Menge über die notwendige Vollendung der Demokratie. Paul und seine Frau Maria engagieren sich aktiv in diesem Umbruch, ihre Tochter Elisabeth studiert in Magdeburg Ingenieurwesen.
Mit der Öffnung der Grenze und der Einführung der D-Mark am 2. Juli 1990 verändert sich alles rapide. Die anfängliche Euphorie weicht zunehmender Unsicherheit. Die ersten freien Kommunalwahlen am 6. Mai bringen die CDU an die Macht, während die Bürgerbewegungen, die die Revolution trugen, marginalisiert werden. Im Theater zeigt sich die politische Spaltung deutlich – von CDU über SPD, Grüne bis zur PDS reichen die Überzeugungen der Kollegen.
Am 3. Oktober 1990 wird die deutsche Einheit im festlich hergerichteten Theater gefeiert. Paul und sein technisches Team haben die Bühne vorbereitet, doch hinter der offiziellen Feier wachsen die Ängste: Arbeitslosigkeit steigt exponentiell, erste Betriebe schließen, die Treuhand übernimmt volkseigene Betriebe. Die versprochene wirtschaftliche Blüte bleibt aus.
Parallel zur politischen Transformation entwickelt sich ein persönliches Drama: Paul erfährt durch seine kurz vor seinem Besuch verstorbene Mutter Elsa in Israel eine erschütternde Wahrheit: Boris‘ Vater Wladimir Tenkow war in Wirklichkeit Adolf Schottmann, ein ehemaliger Nazi-Oberstleutnant, der 1933 Pauls Vater Gottfried Derenburg, einen jüdischen Bühnenmeister, verhaftet und ins KZ gebracht hatte, wo dieser starb. Schottmann desertierte in Stalingrad, wurde in sowjetischen Umerziehungslagern zum Kommunisten, heiratete eine Russin und kehrte mit Walter Ulbricht als Wladimir Tenkow nach Deutschland zurück, wo er Karriere in der SED machte.
Während die große Politik ihre eigene Dynamik entfaltet, kämpft das Theater ums Überleben. Westdeutsche Berater sprechen von „Strukturanpassungen“ und „Personaloptimierung“. Der Intendant sucht sich bereits Alternativen in Österreich. Die 250 Mitarbeiter des Theaters ahnen, dass ihre Arbeitsplätze gefährdet sind. Gleichzeitig entsteht eine zarte Liebesbeziehung zwischen dem deutlich älteren Boris und der jungen Birgit Prey, Regieassistentin am Theater, die gemeinsam von einem Neuanfang träumen – vielleicht in Italien.
Der Roman verwebt geschickt persönliche Schicksale mit der großen Geschichte. Er zeigt den Zusammenbruch alter Gewissheiten, die schwierige Suche nach Identität in einer Zeit radikalen Wandels, die Last der Vergangenheit über drei Generationen hinweg und die Ernüchterung, als klar wird, dass die Wiedervereinigung weniger ein Zusammenwachsen als eine Übernahme bedeutet. Die anfängliche Hoffnung auf demokratische Teilhabe und wirtschaftlichen Aufschwung weicht der bitteren Erkenntnis struktureller Benachteiligung.
Als eBook und Hörbuch auf Elevenreader.io verfügbar.
